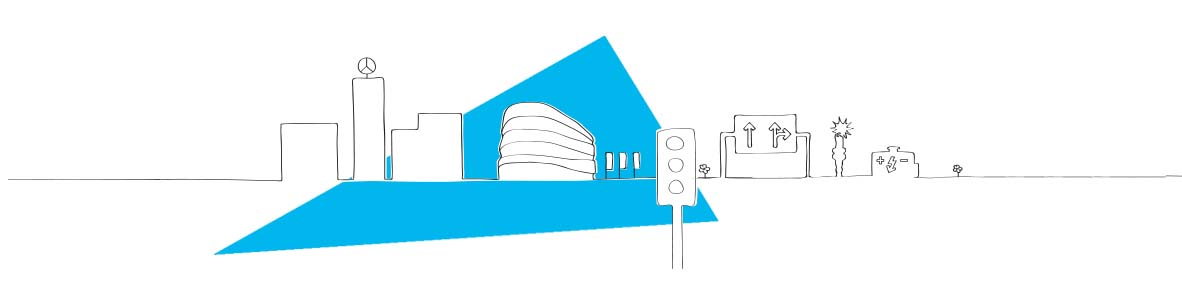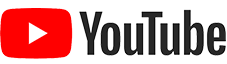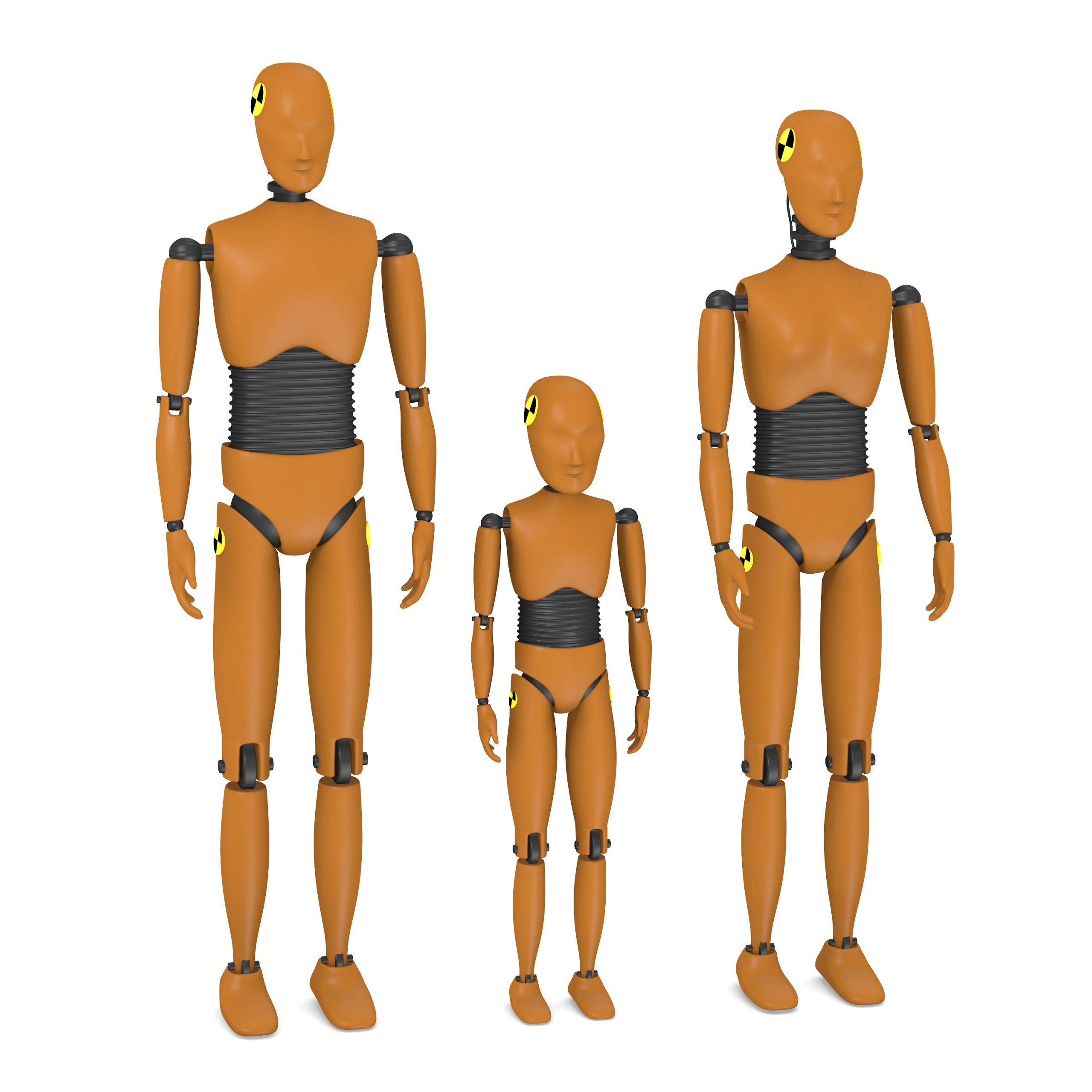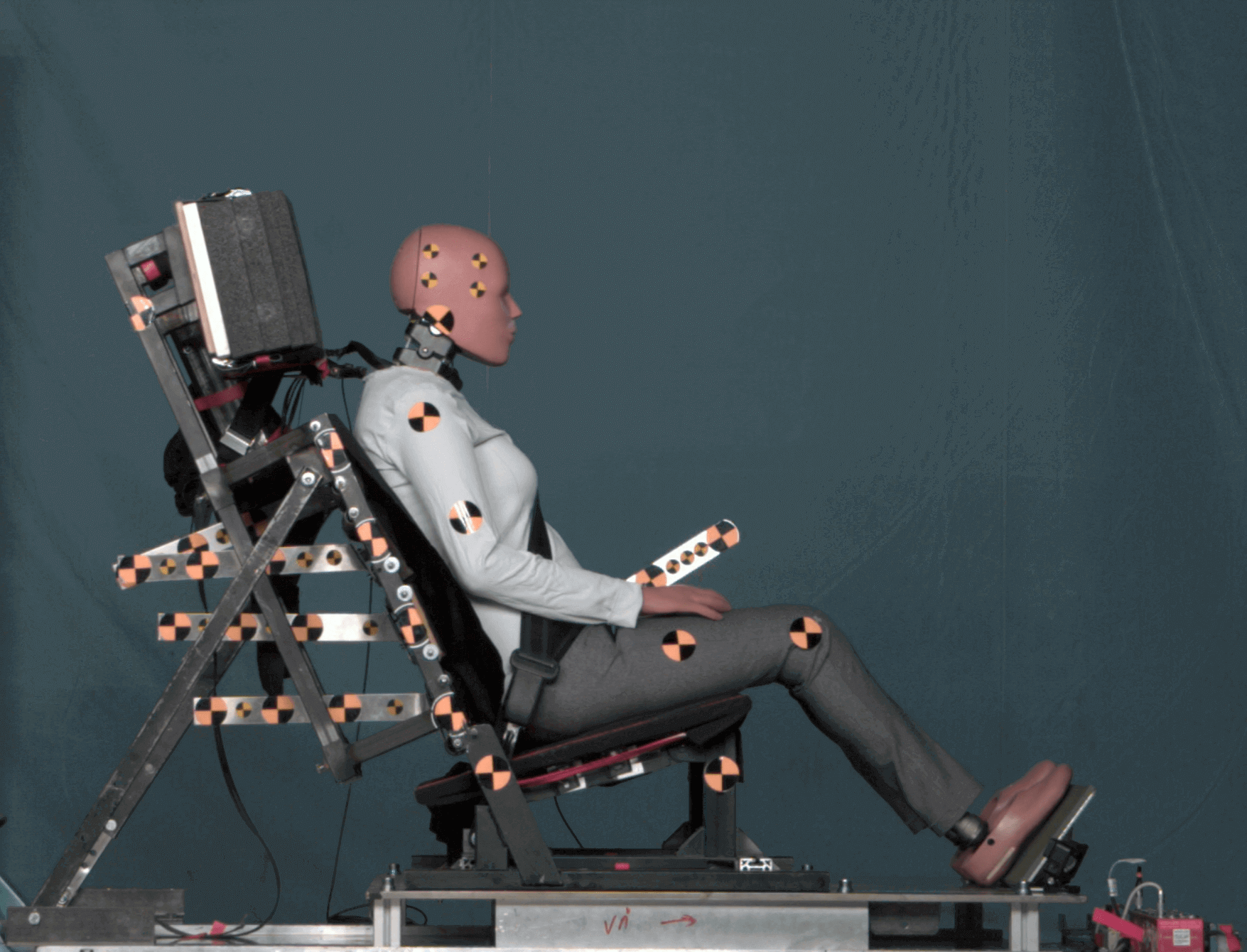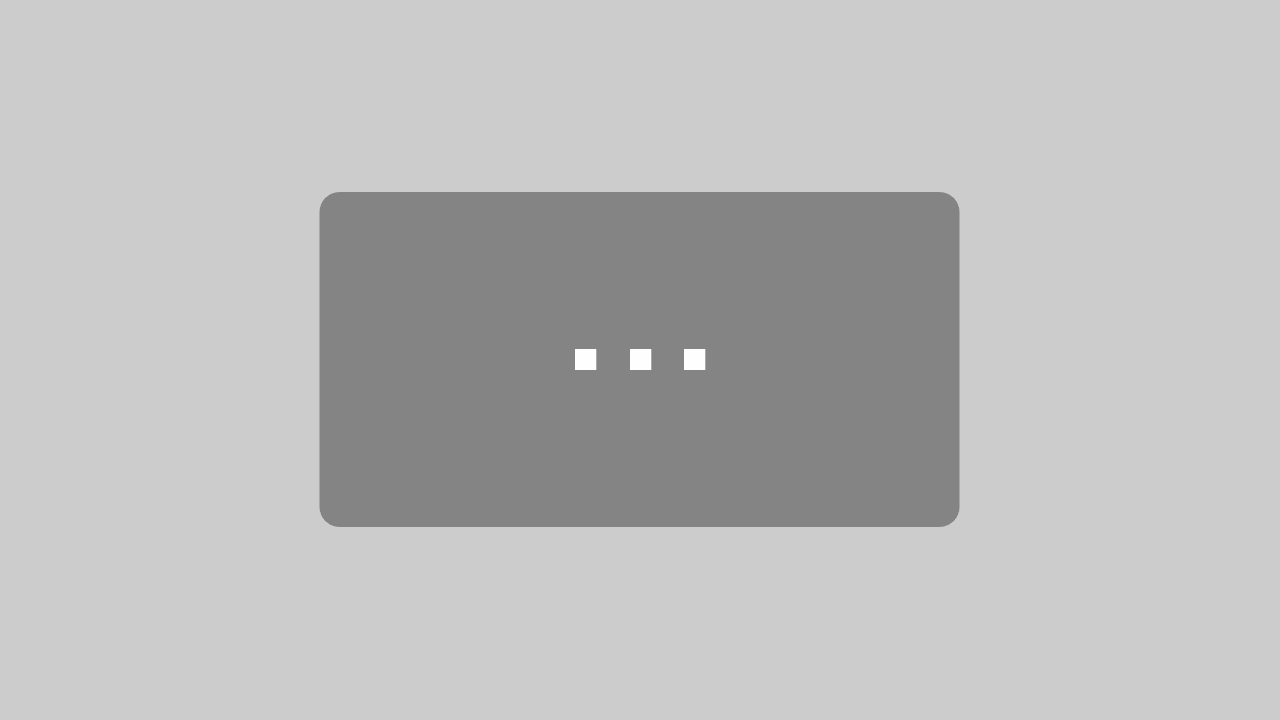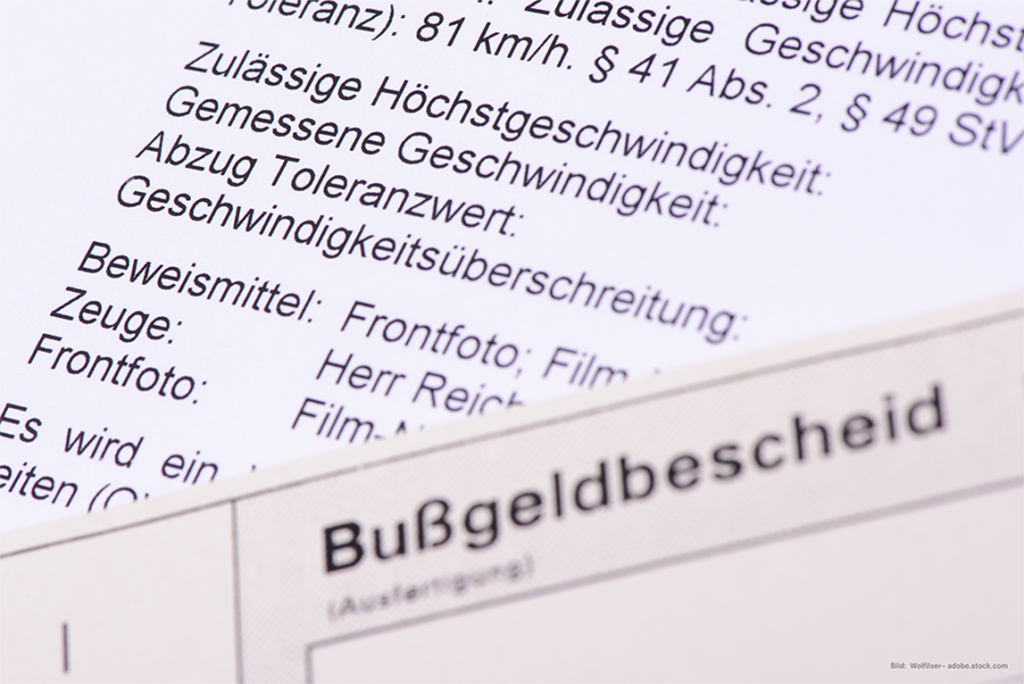Die Blockchain ist eine Technologie, die deine Daten sicher speichert und zwar so, dass sie niemand verändern kann. Wie das funktioniert und welche Rolle dabei Begriffe wie “Miner” oder “Nonce” spielen, kannst du in unserem letzten Artikel nochmal nachlesen. Dabei haben wir schon erfahren, dass es zahlreiche Bereiche gibt, in welchen die Technologie angewendet werden kann. Doch von welchen Bereichen sprechen wir hier genau und wie können wir uns das vorstellen? Lass uns gemeinsam herausfinden, ob die Blockchain dir bereits heute manchmal in deinem Alltag begegnet.
Wo findet die Blockchain schon heute ihren Einsatz?
- Kryptowährungen: Als die Blockchain-Technologie 2008 entwickelt wurde, wurde sie vor allem als Grundlage für Kryptowährungen benutzt. Kryptowährungen, z. B. Bitcoin, sind digitales Geld, mit dem wir im Internet bezahlen können. Die Blockchain ist deshalb so wichtig für die Zahlungen mit Bitcoin, weil sie wie ein sicheres digitales Buch ist, in dem alle Bitcoin-Zahlungen gespeichert sind. Weil jede und jeder sehen kann, was gezahlt wurde und die Zahlungen nicht verändert werden können, brauchen wir hier keine Bank, die dafür sorgt, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
- Vertragssicherung: Stell dir vor, du spielst ein Spiel mit einem Freund, bei dem der Gewinner einen Preis bekommt. Du gewinnst das Spiel, aber dein Freund hat es sich anders überlegt und will dir den Preis nicht geben. Es wäre doch eigentlich toll, wenn du die Sicherheit hättest, dass du deinen Preis automatisch bekommst, sobald du gewinnst und nicht darauf warten musst, dass dein Freund ihn dir gibt. So funktioniert die Funktion „Smart Contracts“. Das sind Verträge, die auf der Blockchain geschrieben und automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das heißt: Sobald du gewinnst, bekommst du auch deinen Preis.
- Lieferkettenmanagement: Angenommen, du kaufst dir einen leckeren Schokoriegel im Supermarkt. Bevor er in deinen Händen landet, muss er viele Abenteuer erleben. Zuerst wird er hergestellt und dann auf eine Reise ins Warenlager geschickt. Hier kommt die Blockchain ins Spiel – wie ein magischer Wegweiser für den Schokoriegel! Die Blockchain sorgt dafür, dass auf dieser Reise alles sicher ist. Manchmal kann es passieren, dass Dinge verloren gehen oder sich verspäten. Aber die Blockchain hilft uns, den ganzen Weg des Schokoriegels von der Herstellung bis zum Laden zu sehen. So können Verkäuferinnen und Verkäufer ganz leicht überprüfen, wo ihre Waren sind. Und du selbst kannst entdecken, welche Zutaten für den Riegel verwendet wurden und wo sie herkommen.
Du siehst also, die Blockchain kann ganz unterschiedlich genutzt werden, um digitale Sicherheit herzustellen.
Blockchain im täglichen Leben
Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wie die Blockchain in Zukunft dein Leben verändern wird? Machen wir eine kleine Reise in die Zukunft: Du hast gerade deine Ausbildung oder dein Studium abgeschlossen. Dafür hast du viele Prüfungen bestanden und erhältst dein Abschlusszeugnis. Es gibt manche Menschen, die ihr Abschlusszeugnis fälschen wollen, zum Beispiel um bestimmte Berufsmöglichkeiten zu haben. Das Fälschen eines Zeugnisses ist natürlich auch heute nicht so einfach, aber durch den Einsatz der Blockchain wird es unmöglich sein, ein Zeugnis zu fälschen. Denn es kann ganz leicht geprüft werden, ob das Zeugnis manipuliert ist.
Nun bist du noch etwas älter und willst ein Haus kaufen. Eine Maklerin macht dir ein gutes Angebot für ein Haus und du sagst zu. Jetzt bräuchtest du eine dritte unabhängige Person, die den Vertrag festhält und sicherstellt, dass du und die Maklerin euch daran haltet, was ihr versprochen habt. Die Blockchain kann durch einen digitalen Vertrag oder Smart Contract alles einfach festhalten und dafür sorgen, dass das Haus nur verkauft wird, wenn sich alle an die Abmachungen halten.

Die Zukunft für Bezahlungen mit Kryptowährungen (z.B. dem Bitcoin) für alltägliche Käufe wie eine Tasse Tee, ist noch nicht abzusehen. Einige Unternehmen haben bereits Versuche mit Kryptowährungen als Zahlungsmittel durchgeführt. Da es hier jedoch zu vielen Herausforderungen kam, wurden die Versuche wieder eingestellt. Ein Problem sind die Kursschwankungen, vielleicht hast du davon schonmal gehört. Der Wert eines Bitcoins kann nämlich sogar innerhalb eines Tages stark schwanken. Dadurch würde sich auch der Preis von Produkten sehr schnell ändern. Das macht es ganz schön kompliziert und auch riskant, wenn du im Café eine Tasse Tee bezahlst. Angenommen, du bezahlst 2 Bitcoins für deinen Tee. Anschließend sinkt der Wert des Bitcoins, sodass der Tee nun 4 Bitcoins wert ist. Damit hat die Verkäuferin bzw. der Verkäufer einen Verlust bei dem Geschäft gemacht. Für alltägliche Zahlungen sind Kryptowährungen daher aktuell nicht gut geeignet.

Was wird uns noch erwarten?
In der Welt der Videospiele spielt die Blockchain bereits eine Rolle. Sie stellt sicher, dass virtuelle Gegenstände wirklich dir gehören – und nicht nur auf dem Server des Spieleherstellers existieren. Es könnte sein, dass du ein einzigartiges Schwert in einem Spiel erwirbst. Dank der Blockchain wird dieses Schwert aufgezeichnet und festgehalten, sodass es wirklich in deiner virtuellen Sammlung bleibt. Dein Spielcharakter hat das Schwert also nicht nur “in den Händen”, es ist auch dein unveränderbares digitales Eigentum. Zudem findet die Blockchain im Metaverse Anwendung, wodurch eine neue Dimension der digitalen Interaktion und Wirtschaft entstehen werden. Wie du im Artikel zur Blockchain Teil 1 erfahren hast, sind Blockchains oft umweltbelastend. Daher arbeiten Forscherinnen und Forscher an umweltfreundlichen Projekten, wie die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zum Schutz des Waldes und des Klimas. Die Blockchain verbessert auch die Nachverfolgung von Lieferketten, fördert nachhaltige Produkte und den Einsatz umweltfreundlicher Materialien. Damit spielt die Blockchain eine wichtige Rolle bei aktuellen Umweltthemen.

Ob und wie die Blockchain unsere Zukunft verändern wird, können wir natürlich nicht genau wissen. Trotzdem ist die Blockchain heute schon in vielen Bereichen unseres Lebens ein wichtiges Thema – vom Hauskauf bis hin zum Klimaschutz oder Gaming. Kein Wunder, dass manche Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die Blockchain unseren Alltag noch mehr verändern könnte als das Internet. Natürlich könnte es aber auch sein, dass eine bessere und schnellere Technologie kommt und die Blockchain in Vergessenheit gerät. Was denkst du? Wird die Blockchain bestehende Technologien ersetzen oder die Kreditkarte sogar ganz ablösen?
Beitragsbild // Adobe Stock: Who is Danny
Hinweis: Die in diesem Text enthaltenen Informationen und Aussagen werden von unserem Team sorgfältig recherchiert und geprüft. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieser Text keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Die primäre Zielsetzung unserer Blogartikel besteht darin, junge Leserinnen und Leser für MINT-Themen zu begeistern und komplexe Inhalte in einer verständlichen Form zu vermitteln.
Stand: März 2024

In diesen Artikeln erfährst du noch mehr zum Thema „Technologie“:
![]()
- Chatbots sind erst der Anfang: Wo Künstliche Intelligenz deinen Alltag bestimmt
- Blockchain Part 1: Hast du schon einmal von einer geheimen Schatzkiste gehört, die nie gestohlen werden kann? Die Blockchain ist eine magische Technologie, die Computer miteinander sprechen lässt
- Von Rechnern zu Denkern: Wie funktioniert die Künstliche Intelligenz?